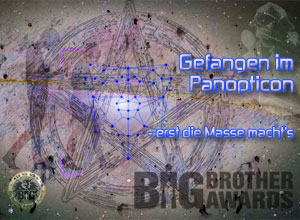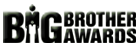

|
search / subscribe / upload / contact |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| RSS-Feed Depeschen | ||

|
||
Date: 2001-06-24
DE: Hearing Cybercrime 5. Juli-.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- 2001 um 15.00 Uhr Plenarbereich Berlin Reichstaggebäude, Raum 3 N 001 I. Bedrohung durch Cyber-Crime / Cyber War: 1. Welche Bereiche des öffentlichen Lebens, d.h. in erster Linie Infrastruktureinrichtungen der Bundesrepublik Deutschland, sind durch einen möglichen Cyber-War-Angriff gefährdet? 2. Welche Erkenntnisse liegen im Hinblick auf die Auswirkungen solcher Angriffe auf die Sicherheit und Arbeitsfähigkeit der öffentlichen Einrichtungen der Bundesrepublik vor? Werden solche Angriffe in virtuellen Szenarien durchgespielt, um die Auswirkungen einschätzen zu können? 3. Wie werden die Arbeit und bisherigen Ergebnisse der so genannten "Internet-Task-Force" des Bundesministeriums des Innern beurteilt? 4. Welche Angriffe auf Einrichtungen der Bundesrepublik Deutschland hat es bisher gegeben, die unter den Begriff "Cyber- Crime/War" fallen könnten und welche Schäden wurde dabei verursacht? Wie hoch waren die finanziellen Schäden durch diese Angriffe? Von wem, Einzelpersonen oder Gruppen, wurden dies Angriffe durchgeführt und gab es danach strafrechtliche Ermittlungen? 5. Wie wird das Risiko einer Ausforschung deutscher Einrichtungen durch technische Anlagen wie "Echolon" o.ä. beurteilt? 6. Welche weiteren ausländischen Abhöreinrichtungen wie "Echolon" sind in Deutschland angesiedelt, die die Sicherheit der Bundesrepublik beeinträchtigen könnten? 7. Aus welchen Ländern oder Regionen ist von staatlicher oder privater Seite mit Cyber- War-Angriffen auf die Bundesrepublik zu rechnen und welche Maßnahmen werden dagegen getroffen? II. Internationale Ansätze - Cyber-Crime: 8. Wie bewerten Sie den Stand der internationalen Harmonisierung der Rechtsbestimmungen zur sog. Datennetzkriminalität? Kann in Europa bereits von vergleichbaren Straftatbeständen, Strafmaßen und Eingriffsbefugnissen ausgegangen werden? Wenn nein, worin liegen die gravierendsten Differenzen? 9. Welche Aktivitäten zur Vereinheitlichung des internationalen Strafrechts in bezug auf grenzüberschreitende Informations- und Kommunikationsnetze existieren derzeit? Welche Initiative halten Sie für am besten geeignet und warum? 10. Wie bewerten Sie die in dem Konventions-Entwurf vorgesehenen Bestimmungen und Regelungen aus verfassungsrechtlicher Sicht? Wahrt der Entwurf beispielsweise das rechtsstaatlich gebotene Gleichgewicht zwischen Eingriffsbefugnissen und Widerspruchsrechten oder wie bewerten Sie die ausgeweiteten Mitwirkungspflichten Privater? 11. Wie bewerten Sie die in dem Konventions-Entwurf vorgesehenen Bestimmungen und Regelungen aus datenschutzrechtlicher Sicht? Inwieweit sind beispielsweise die Begriffsbestimmungen des Entwurfs kompatibel mit bestehenden internationalen Datenschutzbestimmungen und welche Voraussetzungen könnten u.U. eine Verwertung von aus dem Ausland auf Grundlage der Konvention übermittelten Informationen vor nationalen Gerichten im Wege stehen? 12. Gibt es gesicherte Erkenntnisse oder bestimmbare Defizite, die die im Entwurf vorgesehene Ausweitung der Eingriffs- und Überwachungsbefugnisse der Ermittlungsbehörden sowie Senkung der Voraussetzungen grenzüberschreitender Rechtshilfe vertretbar oder notwendig erscheinen lassen? 13. Welche Auswirkungen erwarten Sie durch die ausdrückliche Einladung des Europarates an Nicht-Mitglieder und/oder Nicht- Unterzeichner der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Cyber-Crime-Konvention beizutreten und so ebenfalls in den Genuß der vereinfachten Rechtshilfe und beschleunigten Ermittlungsverfahren zu kommen? 14. Wie bewerten sie die Bestimmungen zur Erfassung von Verbindungs- und Inhaltsdaten in Echtzeit aus technischer Perspektive? Welche spezifischen Differenzen müssen in paketvermittelten Datennetzen im Vergleich zur klassischen Telefonüberwachung berücksichtigt werden? 15. Stellt der Konventionsentwurf aus ihrer Sicht eher eine begrüßenswerte Vereinheitlichung internationaler Rechtsnormen und strafprozessuraler Regelungen dar oder ergeben sich aus seinen Bestimmungen Probleme hinsichtlich einer Ausweitung von Überwachungs- und Eingriffbefugnissen resp. einer Senkung der Voraussetzungen für internationale Rechtshilfe? 16. Der Entwurf sieht vor, dass die Umsetzung in nationales Recht allein nach Maßgabe der bestehenden nationalen Rechtsbestimmungen und Rechtstraditionen erfolgen soll. Ist dieser Mechanismus Ihres Erachtens hinreichend, um einer substanziellen Aushöhlung bestehender Rechtsnormen und Senkung des Grundrechtsschutzniveaus - beispielsweise in Einzelstaaten aber auch innerhalb der Europäischen Union - entgegenwirken zu können? III. Nationale Ansätze - TKÜV: 1. Ist es zulässig, die geplanten, teilweise weit reichenden Eingriffe im Rahmen der TKÜV durch eine einfache Rechtsverordnung zuzulassen oder ist ein förmliches Gesetz notwendig? 2. In welchen Ländern gibt es ähnliche Regelungen und welche Erfahrungen wurden bereits mit ihnen gemacht? 3. Inwieweit sind diese Regelungen zwischen den Staaten harmonisiert? 4. Wie hoch waren die Kosten für die Verpflichteten in diesen Ländern? In welchem Verhältnis stehen sie zum Umsatz der Verpflichteten? 5. Mit welchen Kosten rechnen Sie im worst case für die Verpflichteten in Deutschland? Bitte spezifizieren Sie einmalige und laufende Kosten. 6. Ist Ihnen bekannt, wieviel Adressen dadurch nicht erfaßt sind, dass z.B. kleine Anbieter und Firmennetze nicht von der Verordnung betroffen sind? 7. Für wie realistisch halten Sie das der TKÜV-E zu Grunde liegende Konzept in Anbetracht der Tatsache, daß der user anonym eine unbegrenzte Zahl von e-mail-Adressen haben kann, auf die er von jedem beliebigen Telefonanschluß zugreifen kann? 8. Sehen Sie in § 8 Nr. 3 der TKÜV-E die Verpflichtung des Verpflichteten, verschlüsselte Daten den Berechtigten unverschlüsselt zur Verfügung zu stellen? 9. Wie beurteilen Sie in Anbetracht der Fortschritte bei den Kryptographie-Programmen die Möglichkeiten der Berechtigten die von den Verpflichteten gelieferten Daten auch faktisch, d.h. entschlüsselt, zu lesen? 10. Sehen Sie in dieser Regelung einen Standortnachteil für die Bundesrepublik Deutschland? Wenn ja, warum? 11. Verstößt die TKÜV-E Ihrer Meinung nach gegen Art. 12 GG? Wenn ja, inwiefern? 12. Wie kann der Verpflichtete der formalen Überwachungspflicht nach § 5 Abs. 1 Satz 2 TKÜV-E genügen und welche Kosten verursacht dies? 13. Gibt es bereits Entwicklungen der Hardware-Industrie, die eine kostengünstige, standardisierte Lösung der Hardware-Problematik darstellen? 14. Inwiefern besteht die Gefahr, daß in das Fernmeldegeheimnis unbeteiligter Dritter eingegriffen wird? 15. Inwiefern besteht die Gefahr einer Datenmanipulation beim Verpflichteten durch die Einrichtung dieser speziellen Schnittstelle? 16. Wie bewerten Sie die Verhältnismäßigkeit des Verordnungs- Entwurfes? 17. Wie bewerten Sie die Bestimmung, dass die Service Provider die Kosten vollständig tragen sollen? Gibt es Alternativen, die Ihnen angemessener erscheinen? Wenn ja, welche? 18. Wer sollte zu dem Kreis der Verpflichteten der TKÜV-E gehören? 19. Besteht auf Grundlage der TKÜV-E aus ihrer Sicht hinreichende Rechtsklarheit? 20. Wie schätzen Sie die Abgrenzungsproblematik der TKÜV-E insbesondere hinsichtlich der Teledienste und Mediendienste nach TDG und MDStV ein? 21. Inwieweit sind die Überwachungsbestimmungen europaweit und auch international vergleichbar und inwieweit basieren sie auf harmonisierten Rechtsnormen und Straftatbeständen? -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- - -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- edited by Harkank published on: 2001-06-24 comments to office@quintessenz.at subscribe Newsletter - -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- -.-. --.- |
|
|
|
| related topiqs | |
| CURRENTLY RUNNING | |
q/Talk 1.Juli: The Danger of Software Users Don't Control

|
|
| !WATCH OUT! | |
bits4free 14.Juli 2011: OpenStreetMap Erfinder Steve Coast live in Wien

|
|